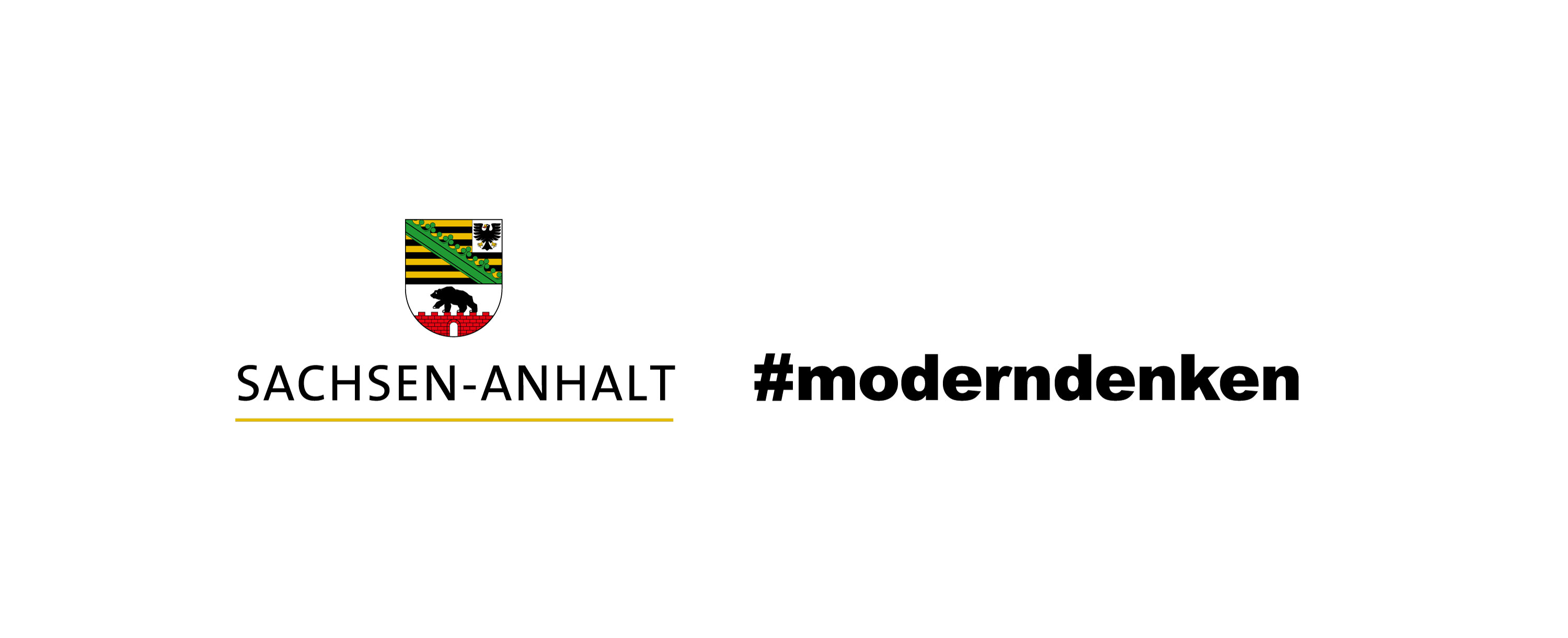Berlin: (hib/AW) Der Gesetzentwurf der Bundesregierung "zur Ergänzung und Änderung der Regelungen für die gleichberechtigte Teilhabe von Frauen an Führungspositionen in der Privatwirtschaft und im öffentlichen Dienst" (19/26689) wird von Sachverständigen aus Wirtschaft und Wissenschaft höchst unterschiedlich aufgenommen. Dies zeigte sich in einer öffentlichen Anhörung des Familienausschusses am Montag über die Gesetzesvorlage sowie zwei Anträge der Fraktionen von FDP (19/20780) und von Bündnis 90/Die Grünen (19/25317).
Die Mehrzahl der geladenen Expertinnen unterstützte das Ansinnen, eine Mindestbeteiligung von Frauen in den Vorständen börsennotierter Unternehmen und in Unternehmen mit Bundesbeteiligung festzuschreiben. Allerdings gingen die Regelungen nicht weit genug, müssten vor allem auf mehr Unternehmen ausgeweitet werden. Zwei der Sachverständigen sahen darin allerdings einen zu großen Eingriff in die unternehmerische Freiheit. Einigkeit bestand aber in der Feststellung, dass Frauen och immer unterrepräsentiert seien in Führungspositionen.
Die Rechtswissenschaftlerin Barbara Dauner-Lieb von der Universität Köln argumentierte, dass es aus rechtlicher Sicht keine Bedenken gegen eine gesetzlich vorgeschriebene Quote oder Mindestbeteiligung für Frauen in den Vorständen gebe. "Rechtlich geht das alles, es kommt nur darauf an, ob man das politisch will." Dies wurde auch von der Sozialwissenschaftlerin Gisela Notz so gesehen. Das Grundgesetz gebe klar vor, dass der Gesetzgeber bestehende Benachteiligungen für Frauen abzubauen habe. Derzeit sei die Hälfte der Bevölkerung massiv unterrepräsentiert in Führungspositionen. Sie forderte zudem "empfindliche Strafen", wenn Unternehmen gegen die Vorgaben verstoßen. Bußgelder würden nicht ausreichen. Denkbar wäre, dass Unternehmen, die die Mindestbeteiligung nicht einhalten, keine Aufträge mehr von der öffentlichen Hand erhalten.
Die Wirtschaftswissenschaftlerin Philine Erfurt Sandhu von der Hochschule für Wirtschaft und Recht Berlin wies darauf hin, dass Deutschland mit einem Frauenanteil von elf Prozent in den Unternehmensvorständen im internationalen vergleich einen der hinteren Plätze einnehme. Seit 20 Jahren setze man in Deutschland an diesem Punkt auf Freiwilligkeit, dies habe zu keinem Erfolg geführt. Den Gesetzentwurf der Bundesregierung hält sie allerdings für "zu vorsichtig", da er de facto lediglich 30 Unternehmen in Deutschland betreffe. Zudem würden die konkreten Vorgaben zu einem Frauenanteil von maximal 21 Prozent führen. Auch Antje Kapinsky vom Verein Spitzenfrauen Gesundheit wünscht sich eine Ausweitung der gesetzlichen Vorgaben für eine Mindestbeteiligung von Frauen auf andere Bereiche. So sei das Gesundheitssystem in weiten Teilen einerseits zwar sehr weiblich geprägt, in den Führungspositionen spiegele sich dies aber nicht wider. In diesem Sinne argumentierte auch die Managerin und frühere Siemens-Vorständin Janina Kugel. Die Vorgaben des ersten Führungspersonalgesetzes hätten nicht funktioniert, aber auch die Vorgaben des geplanten zweiten Gesetzes würden dazu führen, dass der Frauenanteil in den Vorständen signifikant unter 30 Prozent bleiben werde. Statt einer Mindestbeteiligung in absoluten Zahlen sollte der Gesetzgeber eine klar definierte Mindestprozentzahl vorgeben. Begrüßt wurde die Gesetzesvorlage zudem von Tanja Demmel als Vertreterin der Kommunalen Spitzenverbände. Sie sei ein wichtiges Signal auf dem Weg zu gleichberechtigter Teilhabe an Führungspositionen für Frauen.
Die Rechtsanwältin Daniela Favoccia wies das Argument zurück, dass es nicht ausreichend Frauen mit entsprechender Qualifikation gebe, um einen höheren Anteil in Führungspositionen zu erreichen. Auch wenn Frauen mitunter in technischen oder naturwissenschaftlichen Fachrichtungen unterrepräsentiert seien, so würden sich auch männliche Vorstandmitglieder zu einer großen Zahl aus Betriebswirten oder Juristen rekrutieren. Von denen gebe es auch genügend weibliche. Zudem hätten die Unternehmen auch die Möglichkeit, Frauen im Ausland zu rekrutieren, wo der Anteil in technischen Berufen mitunter deutlich höher sei.
Kritisch beurteilten hingegen die Unternehmensjuristin Friederike Rotsch vom Chemie- und Pharmaunternehmen Merck und die Unternehmerin Sarna Röser vom Verein Die Familienunternehmer die gesetzlich vorgegebene Mindestbeteiligung von Frauen. Sie bezeichnete die Vorgaben als einen "erheblichen Eingriff in die internen Strukturen und Gremien privater Unternehmen". Feste Quoten und Zielgrößen seien aber nicht zielführend, um den Frauenanteil zu erhöhen. Rotsch sprach sich zudem dagegen aus, dass auch eine Verlängerung einer Vorstandsmitgliedschaft unter die Auflagen fallen. Diese Fälle müssten von den Vorgaben ausgenommen werden. Röser argumentierte, feste Quoten würden nicht die Ursachen beseitigen, warum so wenige Frauen in Führungspositionen vertreten seien. Es müsse vielmehr ein "Kulturwandel" eingeleitet werden. So müssten beispielsweise die Rahmenbedingungen deutlich verbessert werden, um die Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern.
Quelle: hib - heute im bundestag Nr. 266, Mo., 1. März 2021, Redaktionsschluss: 17.32 Uhr